Bachs Toccaten und eine Neu-Entdeckung :
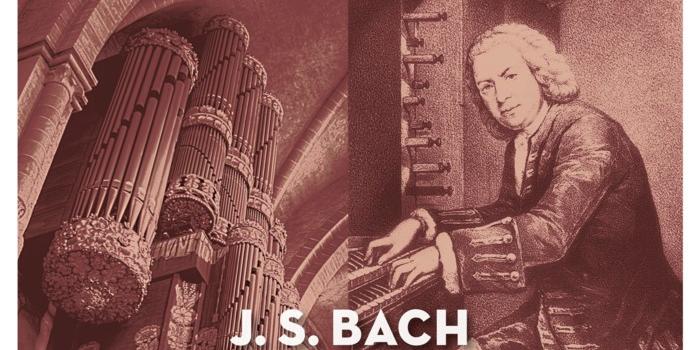
Es ist ein schillerndes Wort. Eines mit Aura. Eines, das Erwartungen weckt. Toccata – bei diesem Begriff schwingen Konnotationen mit: der (berechtigte) Wunsch nach Ereignis, Spektakulärem und Virtuosität. Etymologisch, also seiner Herkunft nach, geht der Terminus Toccata aufs italienische „toccare“ zurück, was schlagen und (be-)rühren meint. So sprach man denn früher zuweilen davon, dass die Organisten aufgrund einer nur schwer gängigen mechanischen Spieltraktur (= Verbindung zwischen Taste und Pfeife) ihre Orgel schlugen. Die frühesten Toccaten stammen aus dem 16. Jahrhundert und beziehen sich auf Musik für Laute oder Instrumentalensemble. Mehr und mehr erfolgte dann eine Verengung des Begriffs auf Musik für Tasteninstrumente. Hinzu kam der Aspekt des Improvisatorischen, etwa als ein fantasieartiges Vorspiel zu einem fugierten Satz. Und dabei blieb es. Die Geschichte der Toccata umfasst im Wesentlichen die Zeit vom Frühbarock eines Claudio Merulo und Girolamo Frescobaldi bis in unsere Tage. Die barocke Lichtgestalt eines Johann Sebastian Bach natürlich inklusive. Von Großmeister Bach liegen Toccaten für Cembalo vor und für Orgel – wobei diese Bezeichnung gerade bei den Orgelbeispielen jedoch nicht in allen Fällen authentisch sein dürfte. Auch von Präludien ist da die Rede. Gemeinsamkeit: Von keiner Bach’schen Orgeltoccata ist ein Autograf auf uns gekommen.
Bachs C-Dur-Toccata BWV 564, die womöglich für eine Orgelprobe geschaffen wurde, ist in ihrer Anlage dreiteilig. Gleich zu Beginn kultiviert der Komponist hier den Aspekt der Virtuosität. Keck, blitzartig, fast wie ein munteres Versteckspiel, hebt ein flinker Manualiter-Teil an, in dem Tonleiter-Elemente auffallen. Vor allem in Zweiunddreißigstel-Werten wird der Tonraum durchmessen, gleichsam abgesteckt. Auf Sechzehntel-Basis folgt ein großes, respektheischendes, flinke Füße erforderndes Pedalsolo mit Terzmotiv, Trillern, Triolen und Echoeffekten, ehe über einen Dominantseptakkord die Tonika und damit der Hauptteil erreicht wird. Ein Satz in Dialogstruktur und mit konzertanten Zügen. Eine klare, festliche, nach vorn strebende Musik, die den Hörer unschwer für sich gewinnt. Diese Sogkraft geht nicht zuletzt auch vom Pedal aus. Der zweite Satz, das „Adagio“ mit pochendem Achtel-Bass, nutzt das uralte und in der Musik vielfach erprobte Modell Melodie plus Begleitung. Seiner Faktur nach gibt es für diesen Satz in Bachs Orgelschaffen kaum eine Parallele. Eine womöglich italienisch beeinflusste Musik, die so tut, als wollte sich hier eine verzierte Solostimme (vielleicht eine Violine) über einem ausgesetzten Generalbass sehr expressiv vernehmen lassen. Eine beseelte, tiefgründige Musik, in die man sich versenken kann. Dazu meditativ und ruhig – und damit hilfreich und heilsam für Leute von heute. Von diesem a-Moll-„Adagio“ moduliert eine „Grave“-Strecke mit Vorhaltsbildungen nach C-Dur und leitet damit zur abschließenden vierstimmigen Fuge über. Zu einer schwungvollen Fuge im Sechsachteltakt mit Durchführungen und Zwischenspielen. Ein Satz, der klar, spielerisch und transparent ist und von dem viel Leichtigkeit ausgeht. Diese als Triptychon angelegte C-Dur-Toccata endet freilich überraschend: Statt Conclusio oder Überhöhung wählt Bach in der Fuge den Weg der Reduktion. Nach wenigen Orgelpunkt-Takten zeigen sich unverkennbar bewusst gesetzte Auflösungserscheinungen, ehe ein kurzer, wie hingeworfener C-Dur-Klang in Ich-habe-fertig-Manier den Schlusspunkt setzt. Da macht sich die Musik aus dem Staub. Das darf sie. Merke: Orgelmusik ist keine humorfreie Zone. Auch der oft so gestrenge Bach kann witzig sein – selbst dort, wo es um Orgel und Kirche geht. Keine Frage: In Sachen Technik und Ausdruck bleibt die C-Dur-Toccata ein überzeitlicher Prüfstein für ambitionierte Organisten.
Die sogenannte Dorische Toccata und Fuge BWV 538 trägt ihren Beinamen eher unberechtigt, ist ihre Tonart doch d-Moll und nicht die alte Kirchentonart. Womöglich dient der Beiname, den man bereits beim Bach-Biografen Philipp Spitta findet, unter anderem der Abgrenzung von der weit populäreren d-Moll-Toccata BWV 565. Von der Dorischen Toccata heißt es, dass Bach sie „bey der Probe der großen Orgel in Cassel“ im September 1732 gespielt habe. Gemeint ist das Instrument in der dortigen Martinskirche. Die (monothematische) Toccata, bei der, wer möchte, Bezüge zu anderen Autoren (André Raison, Pachelbel) entdecken kann, ist in ihrem Charakter dialogisch konzipiert. Die Angaben „Oberwerk“ und „Positiv“ stammen, wovon auszugehen ist, vom Komponisten höchstpersönlich. Der Kontrast zwischen Tutti und Solo wird hier zum Stilprinzip. Einflüsse der italienischen Konzertform sind feststellbar – man denke in diesem Zusammenhang an Bachs Übertragung des Vivaldi’schen d-Moll-Konzerts BWV 596. Die Toccata mit ihren rhetorischen Reminiszenzen ist gewichtig; man sollte sie daher keinesfalls zu schnell spielen. Die vierstimmige Alla-breve-Fuge ist kontrapunktisch ungemein dicht gefügt. Das Thema hat zwei Kontrasubjekte, und die Zwischenspiele sind kanonisch strukturiert. Kurz vor den akkordischen Finaltakten erscheint das Thema kanonisch in der Tonika. Aus der Dorischen Toccata nebst Fuge spricht Ernst. Und d-Moll war die Tonart, in der sich Bach offenkundig besonders gern kontrapunktisch verwirklichte – auch die späte, Fragment gebliebene „Kunst der Fuge“ steht ja in dieser Tonart. Wenngleich „aber ein gantzes Werck von lauter Fugen hat keinen Nachdruck, sondern ist eckelhafft“, wie der Hamburger Johann Mattheson (1681 bis 1764), der kenntnisreichste Musiktheoretiker seiner Zeit, in seinem Werk „Der Vollkommene Capellmeister“ kritisch anmerkte. Wie dem auch sei: Matthesons „Capellmeister“ erschien 1739, in dem Jahr, als Bach den der Orgel zugedachten Dritten Teil seiner Clavierübung vorlegte. Die „Kunst der Fuge“ indes war da noch nicht geschrieben. Unter Bachs Orgelwerken setzt die Dorische Toccata mit ihrer Fuge nicht dezidiert auf organistische Virtuosität und Tastenartistik. Dieses Werk ist eher ein intellektuelles Hörvergnügen, das sich mehr an den Kenner und Liebhaber als Adressaten richtet. Dass der Leipziger Thomaskantor es in Kassel bei einer Orgelprobe zum Besten gab, unterstreicht, dass er Kopf und Praxis zu verbinden wusste.
Bei der Choralfantasie „Wo Gott der Herr nicht bei uns hält“ BWV 1128 fällt die hohe Nummer und dies obendrein abseits der Orgelabteilung im Werkverzeichnis auf. In Wolfgang Schmieders Verzeichnis der Werke Bachs von 1950 waren lediglich die ersten fünf Takte bekannt. Im März 2008 hatten zwei mit Entdeckerglück gesegnete Musikwissenschaftler die ganze Choralfantasie in Neuerwerbungen der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle gefunden. Im Nachlass des Thomaskantors und Bach-Herausgebers Wilhelm Rust tauchte eine komplette Abschrift aus dem Jahr 1877 auf, von der aus sich die Geschichte des Werks lückenlos bis in die Nähe Bachs rekonstruieren lässt. Die Qualität des Fundes gibt zu keinerlei Zweifel an der Autorschaft Anlass. Es handelt sich um eine Kreation aus Bachs Frühzeit – zwischen 1708 und 1710 könnte sie entstanden sein. Um die Jahreswende 1705/06 hatte der aufstrebende, lernbegierige Bach von Arnstadt aus ja die mehrmonatige Reise zu Dietrich Buxtehude nach Lübeck unternommen. Und so lässt sich der Einfluss der norddeutschen Kunst der Choralbehandlung denn auch bei diesem Werk feststellen. In einem Genre wohlgemerkt, das der spätere Bach dann kaum mehr gepflegt hat, das er aber, wie wir durch das überlieferte Lob aus dem Mund des greisen Johann Adam Reincken wissen, der den Kollegen live als Improvisator gehört hatte, gleichwohl souverän beherrschte. Der Cantus firmus, die Choralmelodie (Wittenberg, 1529), erscheint in verschiedenen Stimmlagen, zunächst im Bass. Ein einführender Choralsatz, wie wir es aus Bachs Choralpartiten („Sei gegrüßet, Jesu gütig“ et cetera) kennen, ist nicht vorangestellt. Bach spaltet den Choral (Text nach Psalm 124) auf. Man nimmt Echoeffekte wahr. Ein improvisatorischer, spielerischer Grundzug ist dieser die Orgel auch in ihren Teilwerken nutzenden luziden Musik bis in die abrundende Coda hinein eigen. Bislang kannte man von Bach in dieser alten norddeutschen Tradition lediglich „Christ lag in Todesbanden“ BWV 718. Jetzt gibt es eine zweite Choralfantasie.
Wir bleiben noch eine Weile in Norddeutschland und beim frühen Bach. Eindeutig in diese Richtung weist nämlich die E-Dur-Toccata BWV 566. Jenes zwischen 1706 und 1708 entstandene, (aus spielpraktischen Gründen?) auch in einer C-Dur-Version existierende Werk, das in den Quellen häufiger als Präludium bezeichnet wird. Die E-Dur-Fassung war, wie man heute annimmt, zuerst da. Und somit eine Tonart, die bis auf wenige Ausnahmen (Buxtehude, Vincent Lübeck) in der barocken Orgelmusik eher selten ist. In seiner E-Dur-Toccata wandelt Bach unverkennbar auf den Spuren seiner norddeutschen Kollegen, von denen hier vor allem Buxtehude und dessen Schüler Nicolaus Bruhns zu nennen wären. Das Werk ist vierteilig. Den Kern bilden zwei Fugen, wobei sich das Thema der zweiten Fuge als Variation des Themas der ersten klassifizieren ließe. Mit seinen Tonrepetitionen verweist Thema I unmittelbar auf Buxtehude. Den Fugen geht ein einleitendes freies, den Stylus phantasticus fast stürmisch bemühendes Präludium voraus; zudem gibt es zwischen den Fugen ein Intermezzo. Bach lebt in diesem Werk nach Herzenslust am Muster der norddeutschen Orgeltoccata seine künstlerische Freiheit aus. In einem Werk, das Feuer hat. Wenn er auch satztechnisch noch nicht die höchste Stufe der Vollkommenheit erreicht hat, so ist dies sicher ein Stück weit den jungen Jahren des Autors geschuldet. Ohne Choral-Anleihe rezipiert Bach hier Vokabular, Grammatik und Syntax der norddeutschen Orgelkunst und formt daraus Eigenes. Man erlebt, dass bereits der junge Bach wie ein Schwamm die Stile seiner Zeit in sich aufsaugt und sie in diesem Zuge individualisiert. Im Ranking der Bach’schen Orgeltoccaten ist das E-Dur-Werk dasjenige, das am seltensten zum Vortrag kommt.
Die F-Dur-Toccata BWV 540 im Dreiachteltakt beginnt mit einer Orgelpunkt-Faktur, wie man sie etwa vom Nürnberger Johann Pachelbel kennt. Ein behänder Oberstimmenkanon zunächst auf der Pedalbasis F, danach auf C. Zweimal findet die Sechzehntelbewegung des Kanons in einem Pedalsolo ihre Fortsetzung. Daran schließt sich ein gewaltiger Ritornellsatz an, der Festlichkeit und Dramatik verbindet. Eine Klangrede, ja fast ein Klangrausch in F-Dur. Auch Bach wusste mithin schon, dass die Orgel in dieser Tonart besonders vorteilhaft klingt – und eben nicht erst Charles-Marie Widor, der dann ja mit der berühmten Finaltoccata in seiner 1879 veröffentlichten fünften Sinfonie den für die spätere französische Orgelkunst bezeichnenden Typus der motorischen Toccata erfand. Bachs energiegeladene F-Dur-Toccata erweckt den Anschein, als könnte ihr Schöpfer in der von ihm entworfenen Klangwelt gar nicht genug schwelgen. Robert Schumanns Kommentar von den „himmlischen Längen“, die er in Franz Schuberts großer C-Dur-Sinfonie auszumachen glaubte, lässt sich mühelos auf diese Toccata übertragen. Die Alla-breve-Fuge ist eine Doppelfuge. Das erste Thema in langen Notenwerten, gleichsam im stile antico, das zweite flotter. Beide Themen werden schließlich kombiniert. Ein Formplan, dessen sich, wenn man so will, in seiner anno 1900 entstandenen B-A-C-H-Fuge op. 46 bis in die Themenbildung hinein zumindest latent auch der Bach-Verehrer Max Reger befleißigt. Bachs Toccata und Fuge F-Dur: Das ist große, berührende Orgelmusik, die für sich selber spricht.
Das mit Abstand populärste Bach-Opus und generell gewiss das bekannteste Orgelstück ist die Toccata d-Moll BWV 565. Die Bezeichnung „d-Moll-Toccata“ ist mehr als nur ein Titel, eröffnet sogar mythische Dimensionen, gilt geradezu als Synonym für Bach, ja für Orgelmusik schlechthin – und zwar primär bei Leuten, die in musikalischen Dingen ansonsten nicht sehr firm sind. Ihrer Häufigkeit verdankt diese Toccata den tendenziösen Beinamen „Epidemische“. Sie wird gespielt und strapaziert. Und sie wurde bearbeitet: Der frühe Reger übertrug sie aufs Klavier (wie auch die E-Dur-Toccata), Leopold Stokowski weitete sie auf orchestrale Breitwand-Dimensionen, und der Münchner (Film-)Komponist („Schlafes Bruder“) Enjott Schneider schuf eine von ihm selbst 1986 in Freiburg uraufgeführte Fassung, bei der sie rückwärts zu spielen ist (was der Name „Ataccot“ bereits andeutet). Zudem musste sie auch schon eine Tongeschlechtsumwandlung über sich ergehen lassen, sprich: den Vortrag in Dur. Hinzu kommen grundsätzliche Fragen in puncto Überlieferung: Stammt die d-Moll-Toccata überhaupt von Bach? Wenn ja: Ist es ein Originalwerk für Orgel oder die Bearbeitung eines Werks für Violine solo? Die Form des Stücks verknüpft die drei Teile Vorspiel, Fuge und Nachspiel. Der Autor hat Sinn für Dramaturgie, setzt auf Effekte und Kontraste, die er mit vergleichsweise einfachen Mitteln erreicht. Etwa zu Beginn mit Pausen, vermindertem Septakkord und raschen Triolen in Oktaven. Der zentrale Fugenteil in Sechzehntelbewegung ist in seiner Struktur ebenfalls eher einfach gestrickt. Am Schluss kehren toccatische Elemente wieder. Wer mag, kann norddeutsche Einflüsse ausmachen. Formal ließe sich auch der Lüneburger Georg Böhm anführen. Dem markanten, düsteren Finalakkord wird die erlösende Aufhellung nach Dur verweigert. Ob nun Bach der Komponist war oder nicht, ob es sich um eine Transkription oder ein Original handelt: Mit letzter Sicherheit lässt sich all das nicht beantworten. Spekulation ist müßig. Man tut gut daran, sich an die Fakten zu halten. Und das heißt im Klartext: Toccata und Fuge d-Moll sind, besonders wenn sie mit Esprit dargeboten werden, ein packendes Stück Musik. Im Konzert der fünf Bach’schen Orgeltoccaten machen sie keine schlechte Figur. Und dass sie beliebt sind: Wer könnte es ihnen verdenken? Eines ist jedenfalls klar: Bachs Toccaten zeigen stilistische Vielfalt. Und sie sind Weltliteratur für Orgel.
Johannes Adam




